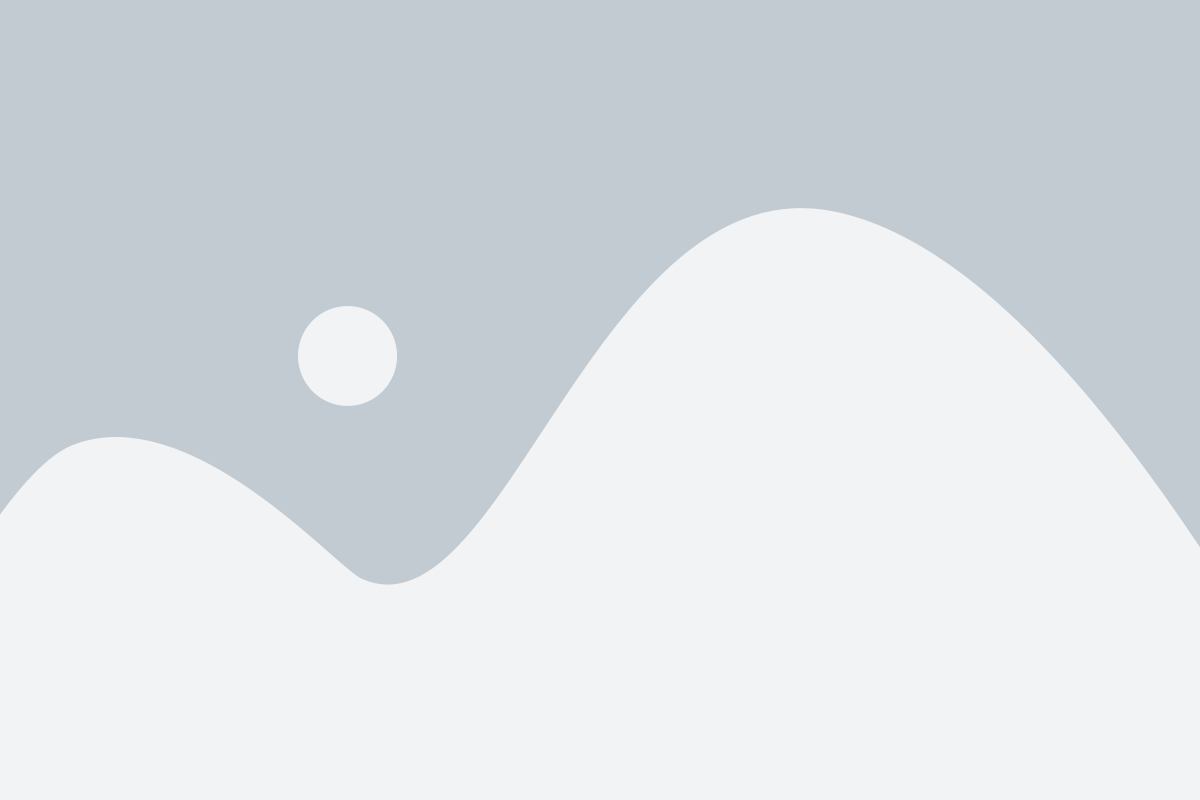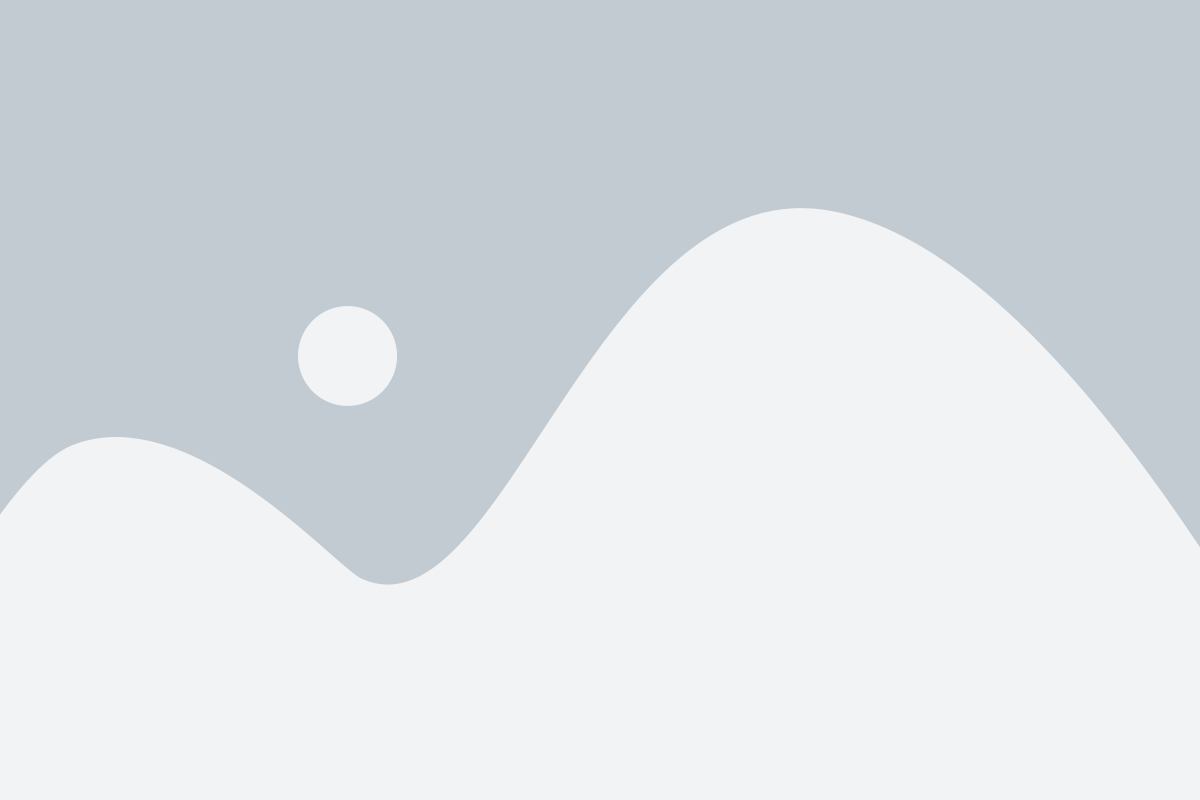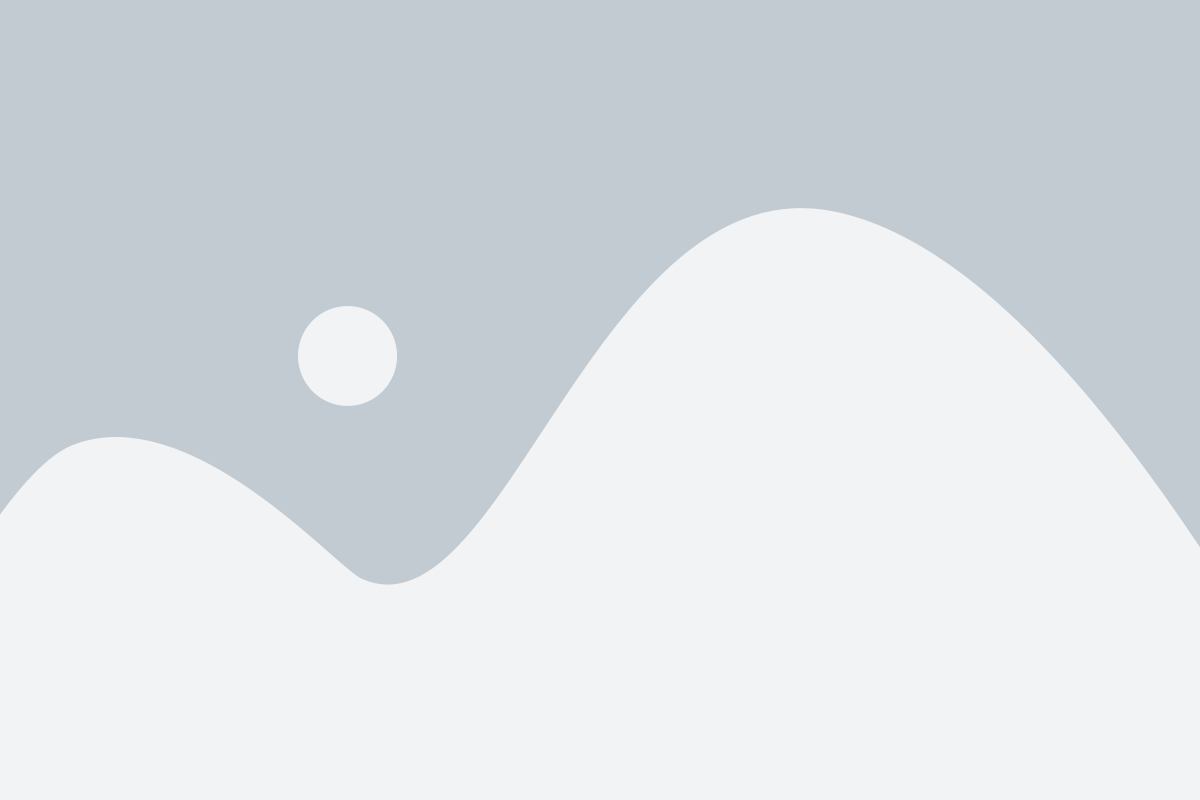Infrarot Energie-Experten AbegSun
Eine Heizung mit höchstem Wirkungsgrad und geringstem Verbrauch info: KI** ⇒
• Prüfzeugnis der TU Dresden über den Wirkungsgrad von AbegSun nach DIN
• hohe mittlere Strahlungstemperatur der Vorderseite von über 145°C
• bis zu 6 cm Dämmung für geringstmögliche rückseitige Wärmeverluste
• erweiterter Abstrahlwinkel von 147° für große Wärmeverbreitung im Raum
• extrem kurze Anheizzeiten von ca. 120 Sekunden auf 100°C Strahlungstemperatur
• geringes Gewicht der Heizelemente, ca. 2-4 kg für leichte Montage und Handhabung
• eingebaute Funk-Thermostatsteuerung für maximales Energiesparen
• Laborforschung und eigene Produktion mit modernster Laser-Fertigungstechnik
• 10 Jahre erweiterte Garantie auf Heizelemente, 2 Jahre auf Elektronik
• umweltfreundlich, nachhaltig, ressourcenschonend, recycelbar, reparierbar
Entdecke mit AbegSun die wunderschöne und faszinierende Welt der energieeffizienten Infrarot-Heizungen und erlebe ein neues Maß an Komfort und Wohlbefinden in Deinem Zuhause. Profitiere von unseren hochwertigen Produkten und lass Dich von uns beraten, um die optimale Heizlösung für Deine Bedürfnisse zu finden.
Mit unseren Infrarotheizungen sparst Du nicht nur wertvolle Energie und reduzierst deine Kosten, sondern schonst auch die Umwelt. Tu Deinem Geldbeutel etwas Gutes und überzeuge Dich selbst von der Effektivität unserer Infrarot-Heiztechnologie.
Bei den uns bekannten Konvektionsheizungen richtet sich die Größe der Heizkörper nach der Heizlast- oder Wärmebedarfsberechnung, – bei einer Infrarot-Strahlungsheizung nach Berechnungsformeln der Quantenphysik.
Ausschlaggebend für die Bestimmung der Größe einer Infrarotheizung sind:
Die Größe eines Infrarotheizkörpers ist unkritisch, wenn er ausreichend groß gewählt wird. Anders als bei einer Konvektions-Zentralheizung entsteht bei einer Überdimensionierung kein Mehrverbrauch an Energie, da der funkgesteuerte Heizkörper nach Erreichen der eingestellten Wohlfühltemperatur automatisch abschaltet. Ist er groß gewählt, schaltet er entsprechend früher ab. Die Energiekosten sind gleich und die Differenz in den Anschaffungskosten beträgt bei AbegSun nur ca. 30 € je Größe.
 Mit mehr Leistung ist man jedoch auch bei Minustemperaturen auf der sicheren Seite. Befindet man sich im Strahlungswinkel eines Heizkörpers, spürt man bereits nach 120 Sekunden die Wärme der Heizung (100°C bei AbegSun). Dieses wird nur beeinträchtigt, wenn die Luftdichtigkeit des Raumes schlecht ist. Der kalte Luftstrom zieht dann auch in den Bereich des Strahlungswinkels und kühlt dort die Personen. Solche Wärmebrücken testen wir auf Wunsch unserer Kunden mit der Infrarotkamera.
Mit mehr Leistung ist man jedoch auch bei Minustemperaturen auf der sicheren Seite. Befindet man sich im Strahlungswinkel eines Heizkörpers, spürt man bereits nach 120 Sekunden die Wärme der Heizung (100°C bei AbegSun). Dieses wird nur beeinträchtigt, wenn die Luftdichtigkeit des Raumes schlecht ist. Der kalte Luftstrom zieht dann auch in den Bereich des Strahlungswinkels und kühlt dort die Personen. Solche Wärmebrücken testen wir auf Wunsch unserer Kunden mit der Infrarotkamera.
Anstatt eines größeren oder eines weiteren Heizkörpers sollte man in diesem Fall lieber die Fenster und Türen abdichten.
Geschätzte Heizkörpergrößen in Abhängigkeit von Raumgrößen bei durchschnittlicher Nutzung
| Raumbeispiele | Größen – gedämmt / ungedämmt | Heizleistung (Watt) |
|---|---|---|
| Küche, Bad WC | >9 m² / 6 m² | 600 W |
| Kinder, Gast, Arbeiten | bis 12 m² / 9 m² | 900 W |
| Schlafen | bis 17 m² / 13 m² | 1120 W |
| Wohnen | bis 24 m² / 20 m² | 2 x 900 W |
| Wohnen + Essen | bis 28 m² / 24 m² | 1 x 900 + 1 x 1120 W |
| Wohnen + Essen | bis 38 m² / 32 m² | 2 x 1120 W |
| Wohnen + Essen + Arbeiten | bis 50 m² mit Raumwinkel / 46 m² | 1 x 600 + 1 x 900 + 1 x 1120 W |
| Wohnen + Essen + Arbeiten | bis 53 m² mit Raumwinkel / 48 m² | 1 x 900 + 2 x 1120 W |
AbegSun Heizelemente werden funktionsfertig mit Tisch-Thermostaten geliefert. Nach elektrischem Anschluss mit Wago-Klick-Klemmen und Hochregeln der Soll-Temperatur schaltet sich das Element automatisch ein. Die Montage ist einfach auf Grund des geringen Gewichts von ca. 2 – 4 kg, einer mitgelieferten Schablone und dem AbegSun 1-Klick-Montagesystem mit Magneten.
Alle unsere Preise enthalten die Mehrwertsteuer, die Kosten der Produkte, eine kostenfreie Anlieferung innerhalb Deutschlands, die Verpackungs- und Versandkosten. Wenn gewünscht, übernehmen wir auch die Montage. Diese allerdings gegen Berechnung.
Alle von uns auf dieser Webseite genannten Preise sind (UVP) – unverbindliche Preisempfehlungen. Bei einem Angebot machen wir eine individuelle, auf Dich zugeschnittene Kalkulation, um Dir den günstigsten Preis machen zu können. – Wir berücksichtigen dabei den Zeitpunkt von Bestellung und Lieferung, den Ort, die mögliche Anlieferung durch uns ohne Verpackungskosten, die Anzahl der Heizelemente usw.
Um eine Kostenübersicht zu bekommen, kannst Du Dir auf dieser Webseite ein Angebot selbst zusammenstellen, auch wenn die Anzahl und Größe der Heizelemente noch nicht feststeht. Du sicherst Dir damit den Preis. Gern beraten wir Dich auch per E-Mail oder Telefon. Wenn gewünscht, erstellen wir eine kostenlose Heizungsplanung mit Montageplan, wenn Du uns einen Grundriss (kann ein Handy-Foto sein) per EMail schickst – siehe Service →
Heizungen mit Steckerthermostat zum Sonderpreis −>
Diese AbegSun Infrarotheizungen mit Steckdosen-Thermostat liefern wir zum Sonderpreis, um es jedem Interessenten zu ermöglichen, die außergewöhnliche Qualität und Effizienz der AbegSun-Heizungen mit geringem Investment zu testen.
Decken-Heizungen −>
AbegSun Decken-Heizelemente haben die höchste Effizienz. Sie können anstatt der Deckenlampe in minutenschnelle montiert werden. Sollte doch eine Deckenbeleuchtung gewünscht werden, kann ein Produkt mit indireketer LED-Beleuchtung gewählt werden.
LED-Decken-Heizungen −>
Diese Heizelemente haben eine indirekte 5 Watt LED-Stripe-Beleuchtung, Effizienzklasse D und eine in das Element eingebaute zusätzliche Funk-Ein-/ Ausschaltung über separaten Drucktaster für die LED-Beleuchtung.
Wand-Heizungen −>
Wand-Heizelemente sind gegenüber Decken-Elementen grundsätzlich nicht so effizient, weil sie einen, wenn auch geringen, Anteil an Konvektionswärme erzeugen. Durch die aufsteigende Luft ist die Oberflächentemperatur ca. 8-10°C niedriger.
LED-Wand-Heizungen −>
Diese Heizelemente können über Eck senkrecht oder waagerecht an der Wand montiert werden. Es sind an den Kopfseiten jeweils 2 LED-Strahler mit 3 Watt Leistung montiert. Spezielles Montagematerial wird mitgeliefert. In das Element ist ein zweiter Funkschalter für das Ein- und Ausschalten der LED-Beleuchtung eingebaut.
Stand-Heizungen mit Rollfüßen −>
Dieses Element ist mit einem 2,5 m langem Netzkabel ausgestattet sowie mit zwei Standfüßen einschließlich Rollen. Es ist ideal als mobile Zusatzheizung geeignet.











RECHTLICHES
Impressum
Datenschutz
AGB´s
INFORMATIONEN
Wirkungsgrad
WEEE-Register
Diese Website verwendet Cookies, um Deine Informationen zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Du damit einverstanden bist, aber Du kannst Dich jederzeit abmelden, wenn Du möchtest. Mehr erfahren